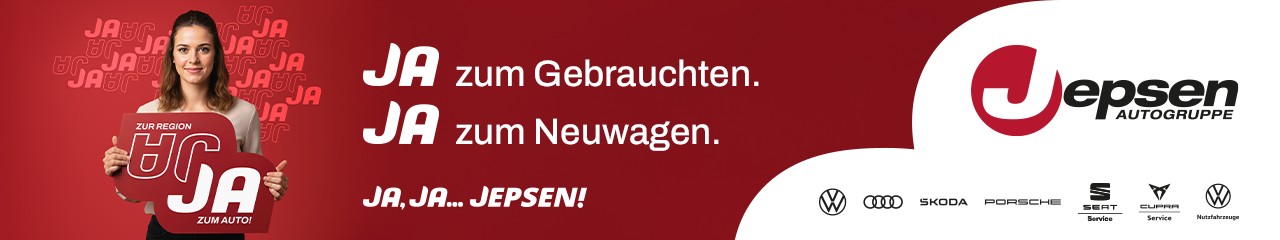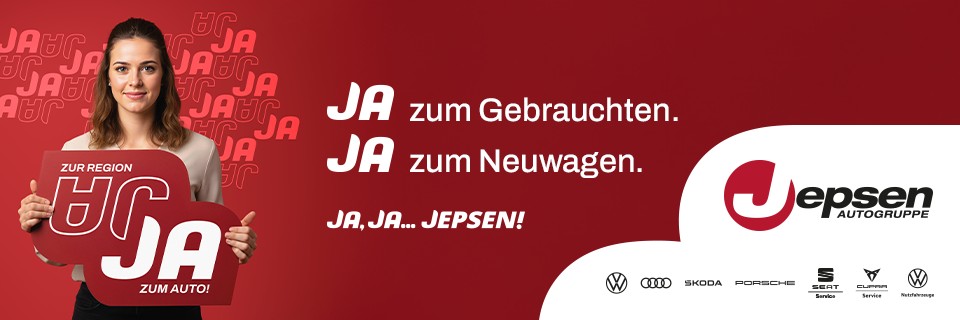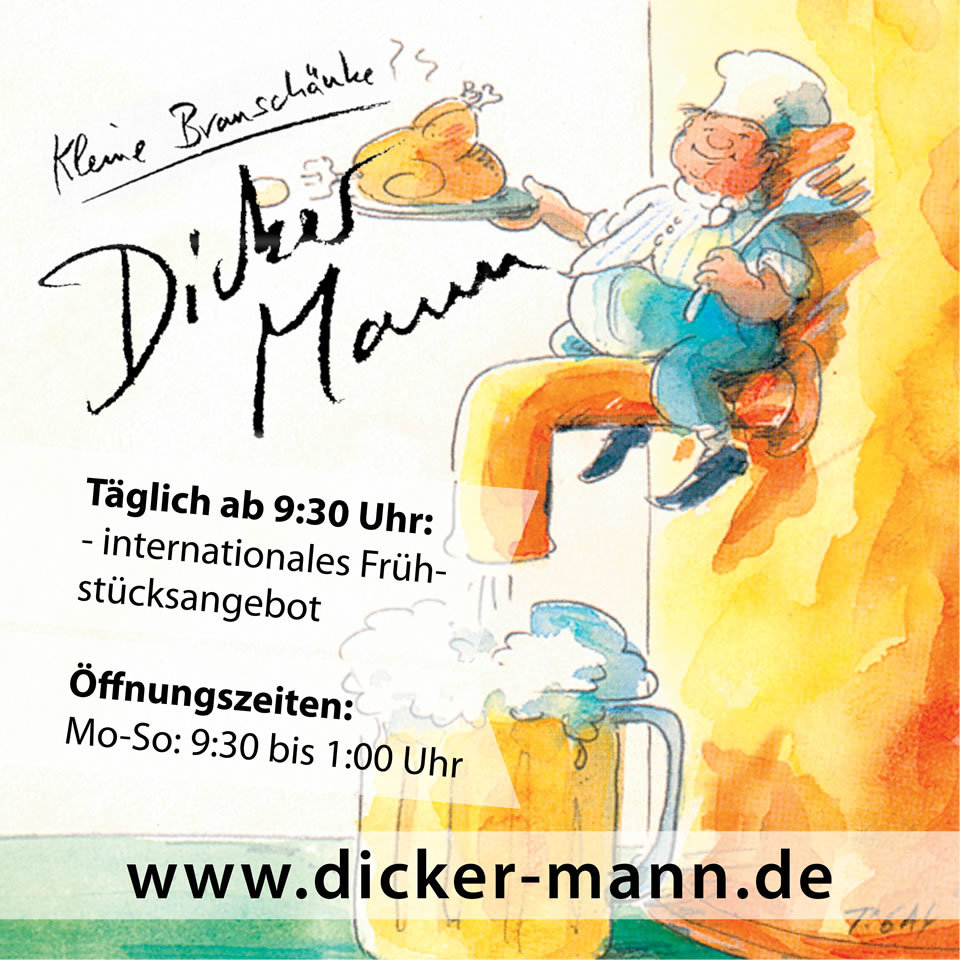Einst für den Wohlstand des mittelalterlichen Regensburgs verantwortlich hat die Donau nie an Kapital für die Regensburger verloren. Nicht nur strömen Zehntausende Touristen pro Jahr vom Fluss in die Altstadt, auch umgekehrt zieht es jedes Jahr Zehntausende Regensburger an die Inseln und Ufergelände des zweitlängsten Stroms in Europa. Die Bedeutung als Naherholungsgebiet für Jung und Alt nimmt dabei jährlich zu. Und das mit Folgen.
Egal ob Kaimauer, Jahninsel oder Wöhrd-Gebiete – die Donau hat es den Regensburgern angetan. Dabei bieten die Ufergelände der Donau mit ihren vorbeiziehenden Fluten mitsamt imposanten Postkarten-Panoramen nicht nur den idealen Treffpunkt für ein gemeinsames Feierabendbierchen von Anwohnern – die extremen Hitzesommer der vergangenen zehn Jahre haben die Donauauen innerhalb der Stadt geradezu zu einem Sehnsuchtsort für viele Bewohner, Besucher oder Angestellte der nördlichsten Stadt Italiens werden lassen. Durch anhaltende Hitzeperioden mit Temperaturrekorden von bis zu 37 Grad erhöht sich seit Jahren der Druck auf die Naherholungsgebiete an Ufer- und Inselbereichen der Donau. Denn gerade die steinerne, in weiten Teilen versiegelte Altstadt erhitzt sich in den Sommermonaten um bis zu vier Grad mehr als die Frischluftschneisen an der Donau.
Während mit den ersten lauen Frühlingstemperaturen auch die ersten Sonnenanbeter damit beginnen, die neu errichteten Hochwasserschutzmauern am Eisernen Steg zu besetzen, füllen sich mit zunehmenden Temperaturen neben den ausgewiesenen Badebereichen an den strömungsarmen Seitenarmen der Donau auch die Kaimauern und Liegewiesen im innerstädtischen Bereich. An heißen Tagen drängen sich die Regensburger hier geradezu dicht an dicht – mit unangenehmen Begleiterscheinungen: Müllaufkommen und Lärm nehmen zu. Eine Entwicklung, die sich durch die spürbar zunehmenden Effekte des Klimawandels mit sich häufenden Hitzewellen in den kommenden Jahrzehnten noch weiter verstärken dürfte.
Übernutzung von Naherholungsflächen
Doch bereits heute hat das Treiben auf den Erholungsflächen in Hotspot-Gebieten im nächsten Umfeld zur Steinernen Brücke ein unangenehmes Maß an Vermüllung und Lärmbelästigung überschritten. Der Zenit der extensiven Nutzung der Donaubereiche wurde durch die weitgehende Schließung von Gastronomie, Bars und Clubs im Corona-Jahr erreicht und mündete im Zusammenhang mit den zu dieser Zeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmen in ein nächtliches Betretungsverbot der Grünanlagen auf Jahninsel und Grieser Spitz: „Menschen, die nicht schlafen können, weil die Bässe, die aus den Boom-Boxen dröhnen, die Wände zum Erzittern bringen. Müll, der sich in Grünanlagen aufhäuft. Glasscherben und weggeworfene Spritzen, die kleine Kinder gefährden. Der Gestank von Urin, der auch am nächsten Tag noch den Aufenthalt in den städtischen Erholungsräumen vergällt“, zählt die Stadtspitze in ihren Ausführungen für das am 18. August 2020 ausgesprochene zeitweilige Betretungsverbot auf.
Selbst wenn es sich beim Corona-Sommer 2020 um eine Extremsituation handelte, bei denen verschiedene Effekte zusammenwirkten, bemerkt die Stadt Regensburg seit längerem einen Anstieg des Müllaufkommens im öffentlichen Bereich. Aufgrund einer Zunahme der „To-Go-Mentalität“ der Bevölkerung wären in den letzten Jahren nicht nur mehr Mülltonnen aufgestellt worden, sondern es werde auch mehr Müll auf den Grünanlagen selbst aufgesammelt. Eine konkrete Steigerung des Müllaufkommens ist aufgrund eines Mangels an Daten zwar nicht nachvollziehbar. Wie prekär die Lage ist, verdeutlicht jedoch eine exemplarische Bestandsaufnahme aus den Sommermonaten 2020. Binnen sechs Wochen wurden auf den Grünanlagen des Grieser Spitz und der Jahninsel 72 Kubikmeter Müll aufgesammelt worden: 60 Hausmülltonnen. Die in der Donau verbliebenen Flaschen, Scherben und Müllreste nicht mitgezählt.
Mehr Zugänge gegen den Druck
Doch was lässt sich tun, um den steigenden Druck auf die Ufer- und Inselbereiche in den kommenden Jahren zu reduzieren? Eine Frage, die die Stadt schon lange beschäftigt und nur unter Berücksichtigung weiterer Einflussgrößen wie Naturschutz, Hochwasserschutz und Interessen Dritter begegnet werden kann. Im Rahmen des 2010 vorgestellten Flussraumkonzepts für Donau und Regen wurde ebenso wie in der Spielleitplanung der Stadt Regensburg aus dem Jahr 2013 versucht, eine Bestandsaufnahme von potentiellen Flächen für weitere Zugänge zur Donau für die Öffentlichkeit zu erstellen, um diese im Anschluss zu prüfen und bei Eignung entsprechende Projekte zu entwickeln und umzusetzen.
So entstanden in den letzten Jahren im Rahmen des Hochwasserschutzes nicht nur in Schwabelweis neue Zugänge mit Sitzstufenanlage und Liegewiese, ebenso wurden in Reinhausen und dem Steinweg neben Hochwasserschutzmauern neue Zugänge an den Flussufern geschaffen. Auch an der Schillerwiese und der Liegewiese am Donau-Nordarm beim Dultplatz wurden die Flächen aufgewertet und ziehen seither immer mehr Anwohner und Regensburger an. Neue Zugänge im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen in Kürze sowohl in Sallern folgen und nach Planungsabschluss auch in den Bereichen Gallingkofen sowie Unterer und Oberer Wöhrd.

Am Nordarm der Donau wurden zahlreiche neue Zugänge zur Donau geschaffen. Heute stellt er einen beliebten Badeplatz mit ausgedehnten Liegewiesen dar.
Konflikte mit Auswirkungen
Dass die Zugänglichkeit der Donau einige Konflikte mit den Interessen Dritter birgt, zeigt dabei vor allem der Bereich Oberer Wöhrd. Hier werden mehrere südorientierte Gleituferbereiche als Vereinsgelände für Motorsportvereine wie dem Regensburger Motorboot- und Wassersportverein (RMWV), der Wasserwacht sowie von Kainz Elektro + Nautic genutzt. Die Bereiche sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wobei gerade das Gelände des RMWV nicht nur in der Spielplanleitung der Stadt Regensburg namentlich als „eine Zäsur“ im Inselpark bezeichnet wird. Seit mehreren Jahrzehnten ist das seit den 60er Jahren vom Freistaat an den RMWV verpachtete Gelände Zankapfel einer scheinbaren Privatfehde zwischen Josef Antes, dem Gründer und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des RMWV, und Walter Cerull, dem Vorstandsvorsitzenden des Donauanlieger Vereins. Für Cerull ist der Motorboothafen des RMWV ein Fremdkörper inmitten der Erholungsfläche Inselpark. Doch nicht nur das: Seit Jahrzehnten dokumentiert er hier Fällungen von Bäumen, die Errichtung von Zäunen sowie den Aufbau von scheinbar nicht genehmigten Anlagen und weiteren Eingriffen in die Natur durch die Pächter. Mehrere Male hat er über Jahre hinweg an das Wasserwirtschaftsamt Regensburg (WWA) appelliert, die Flächen zu kündigen und sich mit diesem Anliegen auch an das Umweltministerium gewandt – zuletzt mit Erfolg. Stand heute läuft der Pachtvertrag mit den am Oberen Wöhrd ansässigen Vereinen und Unternehmen am 31.12.2021 aus.
Der neue Vorstandsvorsitzende des MRWV, Wolfgang Prause, betrachtet die Entwicklungen der jahrzehntelang andauernden und mit Eifer geführten Personalfehde des Gründers Antes mit Sorge. Die Vorwürfe Cerulls stoßen bei ihm auf Unverständnis und Sachverstand. Zum einen seien alle Baumaßnahmen auf dem Gelände nachweislich genehmigt und zum anderen pflege der Verein seit Jahrzehnten die etwa 250 Meter Uferlinie von der RT-Halle bis zum Clubgelände. Ein Grünstreifen, der entgegen der Annahmen von Cerull nicht nur den Clubmitgliedern, sondern allen Erholungssuchenden kostenlos zur Verfügung steht. Lediglich etwa 50 Meter Uferlinie müsse der Verein aus haftungsrechtlichen Gründen eben einzäunen. Darüber hinaus hätte es in der Stadtöffentlichkeit nie Einwände gegen die Vereinsaktivitäten gegeben – mit Ausnahme der Personalie Cerull, die sich öffentlich immer wieder kategorisch gegen Motorboote jeglicher Art am Oberen Wöhrd ausgesprochen habe. Zwar bekunde das WWA bereits seit 2015 sein Interesse an der Verlagerung der Stege, die Suche nach möglichen alternativen Standorten seien aber wegen den damit verbundenen Eingriffe in sensible und geschützte Ökosysteme oder wegen der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit auf dem Wasser nie zu einem konkreten Ergebnis gekommen.
Die Kündigung bleibt für den Verein somit ein Schock – zumal er ohne geeigneten Standort das Aus für den Verein bedeutet. Die Stilllegung und der Abbau der Stege betreffe nicht nur weitere Vereine, sondern bedeute auch für die Firma Kainz das wirtschaftliche Aus in Regensburg. Ohne die Einnahmen aus Reparatur und Wartung von Motorbooten gehen dem Unternehmen 75 Prozent des Umsatzes verloren. Ebenso wären Notreparaturen, Unfallhilfen und weitere Leistungen ohne Liegeplätze für Kunden und Notdienste nicht mehr möglich. Die Kündigungen hätten aber auch zur Folge, dass den zahlreichen auswärtigen Bootswanderern eine wichtige Ausstiegstelle genommen werde. Für den Vorstandsvorsitzenden des MRWV Prause steht dabei fest, mit den Kündigungen wird der Motorbootsport aus Regensburg vollständig verschwinden. Ein Hobby, das entgegen einer weit verbreiteten Ansicht keine elitäre Angelegenheit sei, sondern von vielen Menschen mit großer Freude und durchaus auch mit kleinem Geld betrieben werde. Ohne Freizeitbote werde Regensburg nicht nur ärmer, sondern in der Bootssaison auch weniger bunt werden.
Bleibt es bei den Kündigungen, soll das Gelände nach Rückbau der Anlagen laut WWA auch für Freizeit- und Erholungszwecke aufgewertet und für die Bürger zugänglich gemacht werden. Eine konkrete Planung wird von Seiten der zuständigen Ämter zwar erst ab Herbst vorgelegt, aber eine Bademöglichkeit steht hier alleine aufgrund der starken Strömungsverhältnisse außer Frage.
Neue Publikumsmagnete als Chance?
Eine weitere Möglichkeit, Druck aus den bekannten Hotspots zu nehmen, bestünde in der Entwicklung von Standorten, die neue Nutzungsmöglichkeiten der Donau ermöglichen und somit als weiterer Publikumsmagnet fungieren. In diesem Zusammenhang machte beispielsweise auch die Idee zur Errichtung einer stehenden Surf-Welle in der Donau im Jahr 2019 auf sich aufmerksam. Für Christoph Eschenwecker, Mitgründer der Initiative „Welle Regensburg“, steht bei der Errichtung einer Welle nach Vorbild des Eisbach München ein wichtiger Grundgedanke im Vordergrund: Die Sensibilisierung der Regensburger, dass die Donau mitsamt ihrer Wasserqualität und der damit einhergehenden Nutzbarkeit ein Privileg darstellt. „Dies ist keine Selbstverständlichkeit verglichen mit anderen Städten, bei denen teilweise Badeverbot herrscht, weil die Qualität des Wassers nicht gegeben ist“, erklärt Eschenwecker. „Daher versuchen wir vor allem auch bei der jungen Generation das Verständnis für Natur und Umweltschutz nachhaltig zu stärken. Nur so haben wir alle etwas von unseren Flüssen und ihren Möglichkeiten.“
Die Idee einer surfbaren Welle ist dabei gar nicht so neu, was auch die amtierende zweite Bürgermeisterin und Unterstützerin der Initiative Astrid Freudenstein weiß: „München hat eine, Nürnberg baut gerade eine, Augsburg plant eine Surfer-Welle. Auch in Schwandorf gibt es eine Initiative.“ Die Idee einer Surfwelle in Regensburg findet sie persönlich „großartig“. Gerade in der immer enger, trockener und wärmer werdenden Stadt trifft die Idee von zusätzlichen Freizeitangeboten schließlich den Puls der Zeit. Wassersport boome in all seinen Facetten, so die zweite Bürgermeisterin. Ähnlich positiv fällt auch die Resonanz der obersten Stadtspitze aus, die vor allem das Engagement der Mitglieder der Initiative lobt. Auch das WWA zeigt sich im Rahmen des Flussraumkonzepts aufgeschlossen für die Idee einer stehenden Welle. Doch genau hier wird es kniffelig. Denn die Errichtung einer stehenden Welle verursacht für jeden Standort eine Einzelfallprüfung. Neben der Einhaltung von wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen, wie dem Erhalt des ökologischen Zustands des Gewässers und des Grundwasserschutzes, müssen öffentlich-rechtliche Kriterien wie Naturschutz und städtebauliche Fragestellungen sowie privatrechtliche Sachverhalte wie Haftungsfragen oder Verkehrssicherungspflicht geprüft werden. Somit verwundert es auch nicht, dass die Idee einer stehenden Welle trotz des eigentlich guten Willens der Regensburger Stadtspitze bei der Frage nach Verantwortlichkeiten auf behördliche Umsicht trifft, die dem persönlichen Enthusiasmus abebben lässt.
Dass die anfängliche Begeisterung schnell in Skepsis umschlägt, blieb auch der Initiative nicht verborgen, die deshalb mit Hochdruck Kontakte knüpft, mit Reinigungs-Initiativen auf sich aufmerksam macht und immer neue Standorte auslotet. Dass die Fließgeschwindigkeit der Donau eine stehende Welle wie im Eisbach München ermöglicht, wurde dabei bereits von der OTH in einer Machbarkeitsstudie bestätigt. Bevorzugter Standort für die Initiative wäre zwar der Donau-Nordarm zwischen Dultplatz und Inselpark. Da die Donau als Bundeswasserstraße gilt, gestalte sich eine Umsetzung einer Dauersurfwelle an diesem Standort laut Eschenwecker allerdings als eher schwierig, weshalb auch Standorte am Regen von der Initiative geprüft werden. Aktuell steht beispielsweise auch das Pielmühler Wehr im Gespräch.
Der Vorteil einer stehenden Surf-Welle für die Regensburger liegt trotz der zahlreichen Hürden und Voraussetzungen eigentlich auf der Hand. Die Errichtung eines neuen Freizeitmagneten an der Donau könnte nicht nur Druck von den bereits intensiv genutzten Flächen nehmen, im Zusammenhang mit der Sensibilisierung für eine saubere Donau könnte sie überdies auch einen Grundstein für eine umweltbewusstere Freizeitkultur legen. Zumal der Blick auf den Wert einer sauberen Donau hauptsächlich durch die Nutzbarmachung des Flusses für die Gesellschaft erreicht werden kann.
„Tabuzonen“ für die Öffentlichkeit
Neben all der Zugänglich- und Nutzbarmachung der Donauufergelände für Freizeit und Erholung gilt es gleichzeitig auch Ruhezonen und Rückzugsorte für die Natur zu erhalten. Wie innerstädtische Ruheräume vom Menschen naturverträglich genutzt werden können, zeigt sich direkt auf dem eigentlichen Hotspot Jahninsel. Während im öffentlich zugänglichen Bereich unter der Steinernen Brücke Freizeit im Hochbetrieb mit all seinen negativen Begleiterscheinungen herrscht, geht es in der direkt daneben liegenden Schwimmabteilung des SSV Jahn Regensburg ruhiger zu. Umringt von Pappeln, Sträuchern und gestelzten Baracken tummeln sich aber nicht nur die Mitglieder des SSV Jahn. Das von der wuchernden Auenlandschaft umringte Traditionsbad gilt heute trotz seiner frequentierten Nutzung als ein Rückzugsort für Biber, Fledermäuse und Bodenbrüter.
Ausschlaggebend für den üppigen Wuchs und das rege Treiben darin, ist der Umgang mit dem Gelände durch die Mitglieder der Schwimmabteilung des SSV Jahns selbst. Sie überlassen hier die ungenutzten Freiflächen nicht nur der Natur, sondern befinden sich im ständigen Austausch mit dem Umweltamt, um das Ihrige für die umgebende Natur zu leisten. Das Engagement reicht vom eingeführten Hundeverbot, um die Nistruhe der Bodenbrüter nicht zu stören, über das Anlegen von Blüh- und Kräuterwiesen mit zertifiziertem Regio-Saatgut für eine Kultivierung von einheimischen Pflanzen bis hin zum Anlegen von Nisthöhlen von Eisvögeln durch das WWA, von denen auch dieses Jahr zwei Stück zur Brut genutzt werden.
Die attraktive Lage des Geländes schafft aber auch Spielräume für potentielle Entwicklungsmöglichkeiten. So heißt es in der Spielleitplanung 2013 beispielsweise: Das Gelände liege an dem Donauarm mit der geringsten Fließgeschwindigkeit in Regensburg überhaupt, was einen sicheren und schönen Badeplatz ermöglichen würde. Um diesen zu verwirklichen, empfehle der Plan die Aufnahme von Gesprächen mit dem Verein und Pächter. Was die Spielplanleitung dabei nicht berücksichtig, erklärt Christian Herbst, Abteilungsleiter des Schwimmabteilung des SSV Jahn. Zwar handle es sich beim Seitenarm aus Sicht der Strömungsverhältnisse um eine sichere Badezone, im Sommer reduziere sich der Frischwasserzutrag allerdings auf praktisch null, was nicht nur zu sichtbaren Kiesbänken unter der Steinernen Brücke führe, sondern auch zu einem sehr brackigen und schlammigen Wasser an den hinteren Uferzonen. Hinzu komme, dass hier immer wieder Müll und Grillgut angeschwemmt werde, ebenso würden zerbrochene Flaschen eine Gefahr darstellen. Aus diesen Gründen nutze auch der SSV den Donauseitenarm kaum bis gar nicht.
Wollte man den Flussabschnitt für die Öffentlichkeit zugänglich machen, hätte dies aber auch Konsequenzen für Baumbestand und Biotope. Durch weitreichende Umgestaltungen der Ufer und Entastungen zum Schutz der Besucher würden nicht nur die Lebensräume der ansässigen Tiere verloren gehen, ebenso gerieten die durch den SSV Jahn eingerichteten „Tabuzonen“ in Gefahr, in denen sich selten Tierarten inmitten des Stadtrubels zurückziehen können.
Die Schwimmabteilung des SSV Jahn ist hingegen alles andere als eine elitäre Tabuzone. Auch wenn die Nutzung des Vereinsgeländes aus versicherungstechnischen und haftungsrechtlichen Gründen nur Mitgliedern des SSV Jahn zusteht, freut sich die auf der Jahninseln ansässige Schwimmabteilung über jedes neue Mitglied – vor allem wenn es aus der Nachbarschaft stammt. Denn hier gilt: Alle anfallenden Arbeiten werden von Mitgliedern selbst ausgeführt. Und wer aus der Nachbarschaft komme, schätze nicht nur die naturbelassene Umgebung mitsamt seiner familienfreundlichen Atmosphäre, sondern sei auch bereit, selbst Hand anzulegen.
Die Donau – Ein Fluss für alle?
Die Donau stellt einen komplexen Lebens- und Wirtschaftsraum dar, dessen Bedeutung für Mensch und Natur in den kommenden Jahren noch weiter anwachsen wird. Die Weichen für eine maximal verträgliche Nutzung wurden dabei in den letzten Jahren bereits gestellt. Die Problematik besteht hierbei bei vorausschauender Planung sicherlich nicht zwangsläufig im Interessenausgleich unterschiedlicher Parteien, wie es aktuell am Oberen Wöhrd der Fall ist. Die Schwierigkeit besteht vielmehr darin, den Wert einer sauberen Donau für alle Nutzer in einer Art und Weise sichtbar zu machen, dass sie in eine nachhaltige Verhaltensänderung mündet. Leuchtturmprojekte wie die Welle Regensburg eignen sich dabei durchaus, außergewöhnliche Örtlichkeiten mit ökologischen Werten zu verbinden. Ziel muss es hierbei allerdings sein, diese Werte langsam aber sicher in eine Kultur der Wertschätzung gegenüber Stadt, Natur und deren Bewohner zu überführen. Nur dann gehört die Donau wirklich allen.