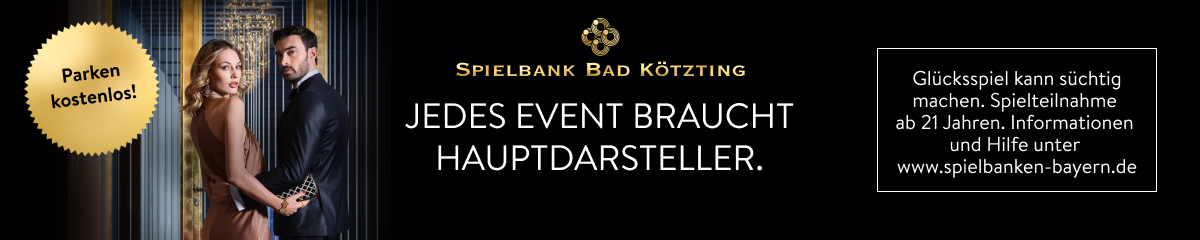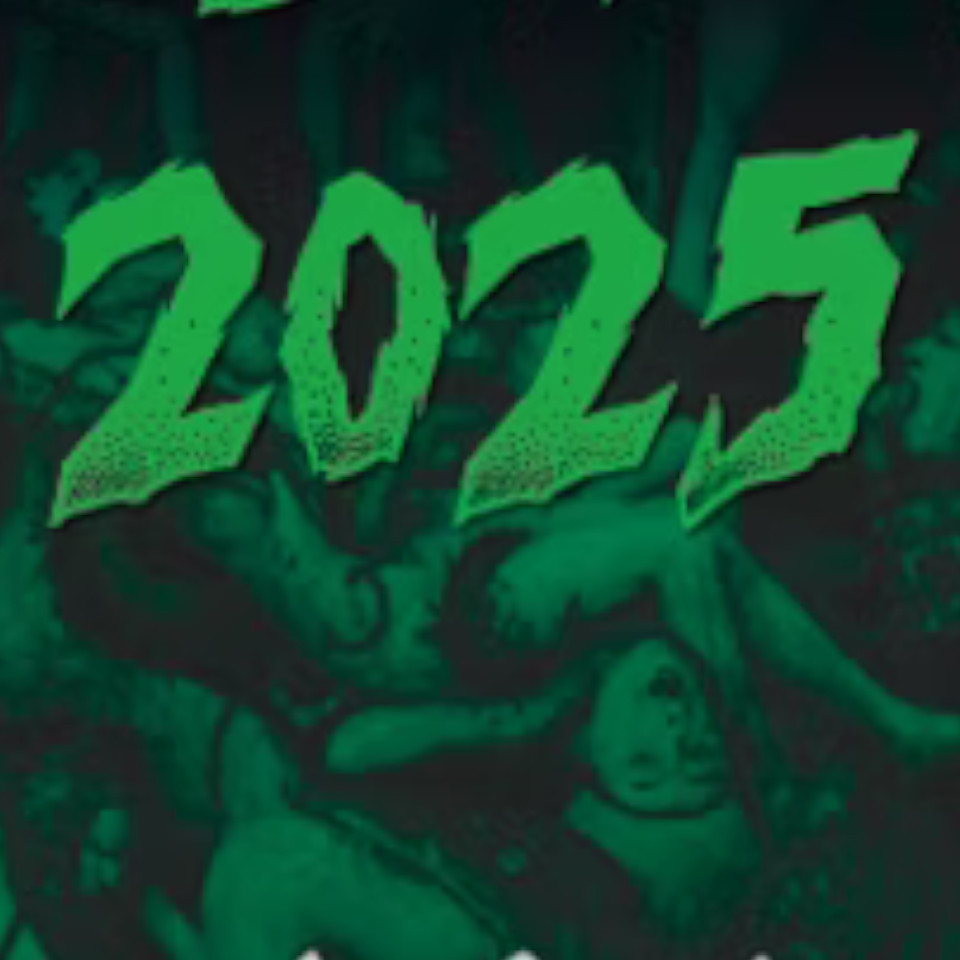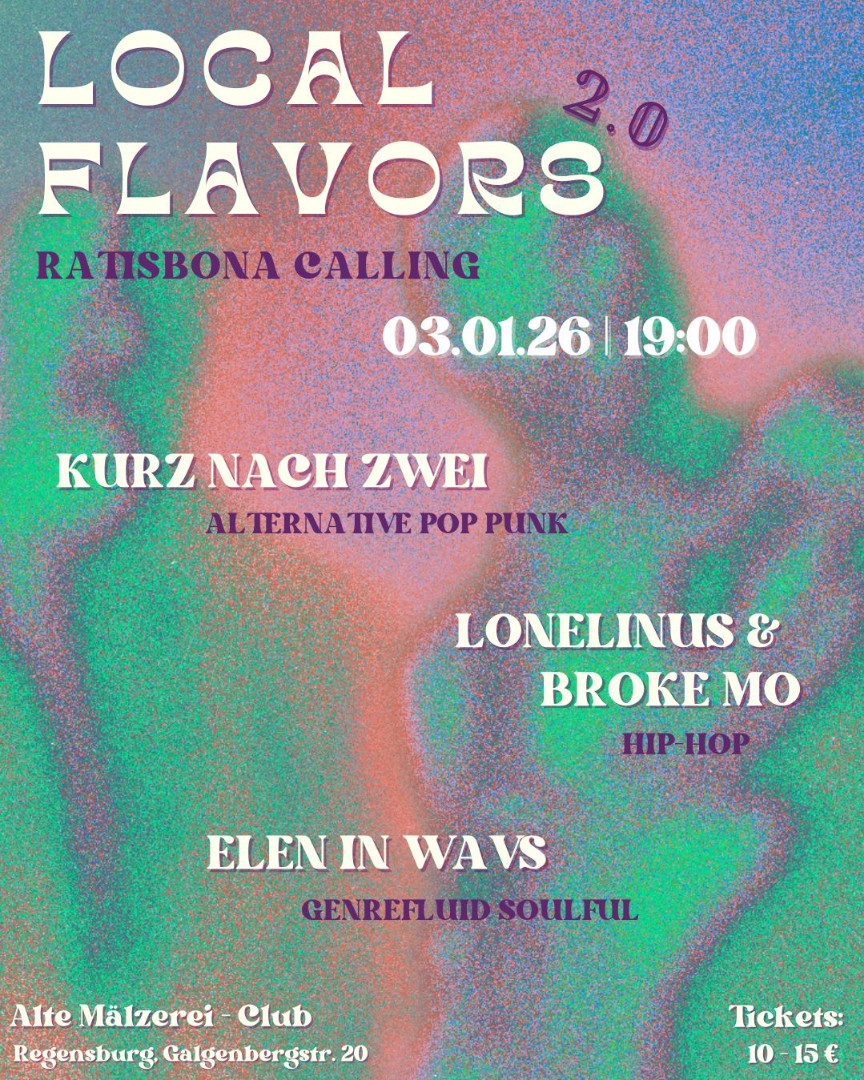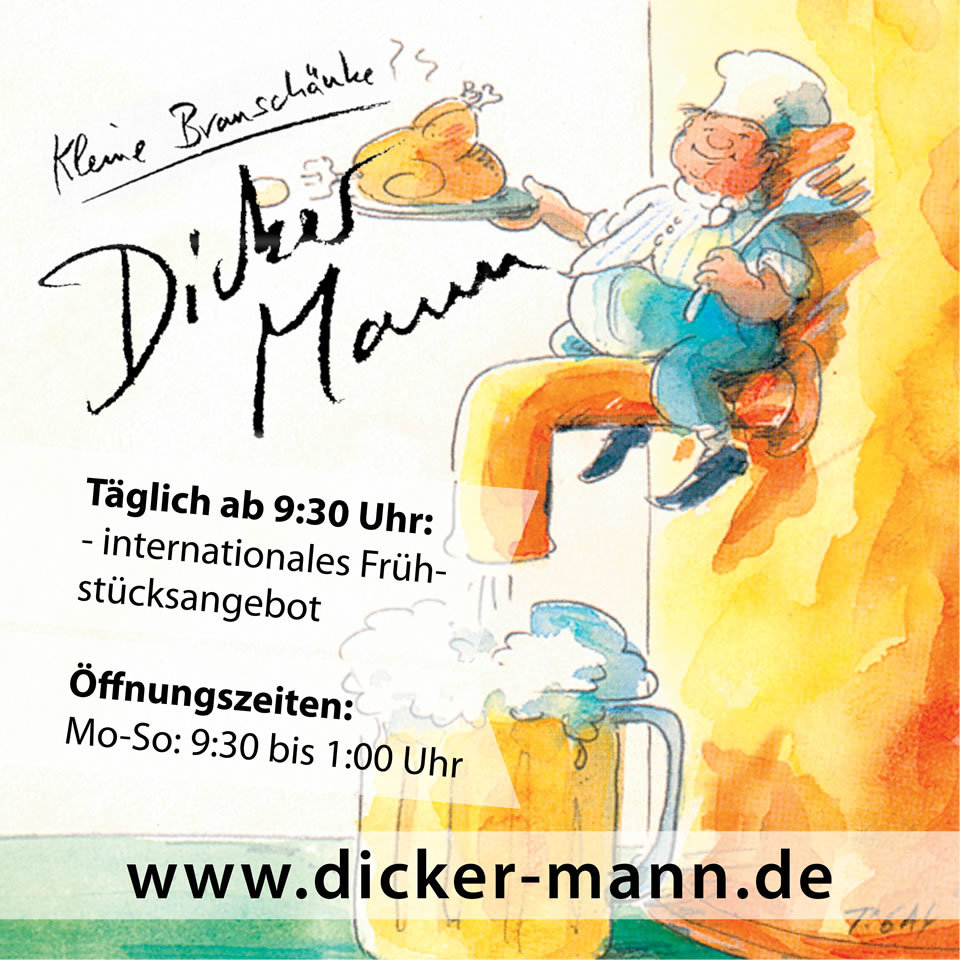Viele von uns kündigen gerne an, weniger Fleisch essen zu wollen, an Hilfsorganisationen im Ausland zu spenden oder regelmäßig den Donaustrudel zu kaufen. Auf Worte folgen dann aber nicht zwangsweise (gute) Taten. Ob es sich hier bereits um Scheinsolidarität handelt und wie sich dieses Verhalten erklären lässt, hat uns Psychologe Prof. Dr. Fischer von der Uni Regensburg erklärt.
Wir möchten gerne, dass die Tierqual ein Ende hat und wollen deshalb Fleisch aus artgerechter Tierhaltung essen oder uns möglichst vegan ernähren. Aber wie oft pro Woche verzichten wir tatsächlich auf den Konsum von Fleisch oder entscheiden uns für teureres Fleisch der Haltungsform 4, wo die Tiere zumindest nach draußen können?
Wir möchten die Meere von Plastik befreien und unser Klima schützen. Aber achten wir selbst bei unserem Einkauf darauf, mehr unverpackte Produkte zu kaufen?
Wir wissen, dass Wasser auch hierzulande ein wichtiges und rares Gut ist. Lassen wir trotzdem beim Duschen immer noch das Wasser durchlaufen? Ignorieren wir den Fakt, dass für die Herstellung einer Jeans 8.000 Liter Wasser verbraucht werden und gehen trotzdem jeden Monat neue Klamotten kaufen?
Wir möchten Flüchtlingen helfen, da wir die Dinge, die ihnen widerfahren sind, schrecklich finden. Doch versuchen wir wirklich, Geflüchtete und ihre Traumata zu verstehen?
Wir können nicht verstehen, warum Menschen und vor allem Kinder in vielen Ländern der Erde noch Hunger leiden müssen. Doch haben wir bereits eine Patenschaft abgeschlossen oder spenden regelmäßig an Hilfsorganisationen?
Draußen leuchten bereits die Lichterketten in weihnachtlichem Glanz, in den Straßen duftet es nach Glühwein und im Radio laufen Weihnachtssongs. Neben Christkindlmarktbesuchen und Weihnachtsfeiern beschäftigen sich die Menschen besonders zur Weihnachtszeit auch damit, etwas „Gutes“ für andere Menschen, Tiere oder die Umwelt zu tun. Doch wie oft setzen wir gute Vorsätze auch tatsächlich in die Tat um und warum scheint diese Motivation bereits zu Beginn des neuen Jahres wieder zu schwinden? Viele von uns kündigen gerne an, weniger Fleisch essen zu wollen, endlich an Hilfsorganisationen im Ausland zu spenden oder regelmäßig den Donaustrudel zu kaufen. Schaut man jedoch genauer hin, folgen auf Worte nicht zwangsweise auch (gute) Taten. Handelt es sich hierbei bereits um Scheinsolidarität oder ist dieses Verhalten psychologisch erklärbar und menschlich? Wie können wir dieses Verhalten bei uns selbst erkennen und verändern? Im Interview von filter und Regensburger Nachrichten hat uns Psychologe Prof. Dr. Peter Fischer von der Universität Regensburg die psychologischen Phänomene, die hinter unserem Verhalten stecken, erklärt. Prof. Fischer ist Dekan der humanwissenschaftlichen Fakultät in Regensburg und seit 2011 Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Sozial-, Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie.
Warum möchten Menschen etwas Gutes tun?
Den Forschungsbereich in der Psychologie dafür nennt man prosoziales Verhalten. Zum prosozialen Verhalten gehören Bereiche wie Hilfeverhalten, Zivilcourage oder auch wenn man jemand anderem einen Gefallen tut. Grundsätzlich ist es so, dass der Homo sapiens ein prosoziales Wesen ist, obwohl natürlich jeder von uns auch negative Eigenschaften wie etwa Aggression in sich trägt. Dazu, warum er sich so verhält, gibt es verschiedene Theorien. Zum einen ist es evolutionär so, dass bestimmte Aufgaben und Ziele nur durch Kooperation, also in der Gruppe, erreichbar waren. Kollektive, in denen soziales Verhalten gelebt wurde, haben besser zusammen gelebt.
Zum Zweiten spielt auch Reziprozität eine Rolle: Wenn ich was Gutes tue, jemandem einen Gefallen tue oder ihm was leihe, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er mir was zurück gibt , wenn es mir mal schlecht geht. Reziprozität ist eigentlich die evolutionäre Komponente, warum man vermutet, dass wir überhaupt prosoziales Verhalten zeigen.
Das Dritte ist, dass wir positive Emotion erleben und uns als guter Mensch, als Humanist, als wichtiger Teil der Gesellschaft, als Altruist fühlen, wenn wir Gutes tun. Alleine dieses Gefühl von gesteigertem Selbstwert ist für viele der Hauptgrund für prosoziales Verhalten.
Gutes Verhalten kann auch durch Impression Management hervorgerufen werden. Wenn einer aus der Gruppe dabei ist, der etwa einem Obdachlosen eine Spende gibt, möchte auch ich im sozialen Kontext keinen schlechten Eindruck machen und gebe etwas her. Oder wenn ich einen Tag zuvor etwa Werbung von der „Dominik Brunner Stiftung“ für Zivilcourage gesehen habe, dann verhalte ich mich auch eher prosozial.
Warum spenden wir oft nur um Weihnachten?
In der Weihnachtszeit überkommt einen oft das Gefühl, für andere etwas tun zu wollen. Wie kommt es gerade in dieser Zeit dazu, dass so viele Menschen spenden?
Es wurde herausgefunden, dass man mehr spendet, wenn man sich gut fühlt und in guter Stimmung ist – im Vergleich zu einer neutralen Stimmung. Wobei wir interessanterweise auch mehr spenden, wenn wir in einer negativen Stimmung sind, weil wir wissen, dass es uns ein Stück weit aus der negativen Stimmung wieder rausbringt. Das bezeichnet man als „negative-state-relief“-Hypothese. Menschen helfen in guten Stimmung, um in guter Stimmung zu bleiben, aber auch in negativer Stimmung, um aus dieser Stimmung rauszukommen.
Ein weiterer Ansatz ist, dass das Weihnachtsfest aus dem Christentum kommt und es dort von St. Martin bis Jesus Christus viele Narrative von selbstlosem Verhalten gibt. Außerdem blickt man in dieser Zeit auch oft auf das Jahr zurück und denkt an die Menschen auf der Welt, die täglich ums Überleben kämpfen müssen, während wir im Wohlstand leben. Durch diesen Kontrasteffekt entsteht kognitive Dissonanz, die wir auflösen möchten, indem wir spenden. Doch Gutes tun und Spenden in der Vorweihnachtszeit taucht auch in der Werbung immer wieder auf, sodass ein nicht-religiöser Mensch ebenso davon angesteckt wird. Das nennt man „Lernen am Modell“. Durch die Medien kann man die Menschen ja in alle möglichen Richtungen schicken, Rechtspopulisten und Fake-News-Leute schicken die Leute zum Beispiel in die falsche Richtung. Wenn sie permanent solche Inhalte lesen, glauben das die Menschen mit der Zeit, das nennt man social influence. Genauso verhält es sich beim Spenden. Wenn ich sehe, wie Menschen Gutes tun, dann lasse ich mich davon natürlich auch beeinflussen. Deshalb gibt es auch Mode, Zeitgeist etc.
Oft nehmen wir uns dann vor, auch im neuen Jahr regelmäßig zu spenden. Warum ist es oft so schwer, diese guten Vorsätze dann auch in die Tat umzusetzen?
Die positive Stimmung, in der wir uns in der Weihnachtszeit befinden, die uns unter anderem zum Spenden animiert, nimmt im neuen Jahr wieder ab, der Alltag zieht ein und somit nimmt auch die Spendenfreudigkeit wieder ab. Ein anderer Erklärungsansatz ist die Einstellungs-Verhaltens-Lücke. Ein ähnliches Beispiel sind gute Vorsätze an Neujahr, die oft nicht umgesetzt werden. Trotzdem ist es besser, jemand hat einen Vorsatz als dass er keinen hat, das ist durchaus wirksam. Aber dann gibt es natürlich viele Faktoren, die einen wieder ablenken. Sobald etwas anderes ins Bewusstsein kommt, drängt das die guten Vorsätze, die ja Kraft kosten, oft wieder in den Hintergrund.
Beim Thema Spenden stellen sich viele von uns auch die Frage, welchen Hilfsorganisationen man vertrauen kann und ob die Spenden überhaupt ankommen. Obwohl es viele kleinere, transparente Hilfsorganisationen gibt, scheinen viele die Unsicherheit, ob das Geld wirklich ankommt, in den Fokus zu stellen, um zu rechtfertigen, dass Spenden nicht viel bringt. Wie ist dieses Verhalten zu erklären?
Das ist klassische Rationalisierung. Mir geht es gut, ich sehe aber, dass es vielen anderen Menschen schlecht geht. Ich bin aber knickrig und denke mir, dass ich selbst nicht so viel Geld hab, gerade in der aktuellen Zeit. Trotzdem bleibt der Gegensatz, dass es mir gut geht und den anderen schlecht, das erzeugt kognitive Dissonanz. Das ist ein unangenehmer Spannungszustand im Kopf – der ist negativ, der ist aggressiv und möchte reduziert werden. Immer wenn wir in unserem kognitiven System oder unserem Bewusstsein so etwas wahrnehmen, dann wollen wir das loswerden. Eine Möglichkeit ist Rationalisierung und in der Folge Dissonanz-Reduktion, indem ich sage: Das kommt ja eh nicht an, dann brauche ich gar nicht spenden. Ein weiterer Faktor ist die Loss Aversion. Der Mensch ist motiviert, Ressourcen anzusammeln und möglichst wenig herzugeben, deshalb spart und wirtschaftet er. Verluste tun über den Daumen gepeilt doppelt so weh wie ein Gewinn gut tut. Das ist auch evolutionär erklärbar, weil ein Verlust von Ressourcen die Wahrscheinlichkeit zu überleben verringerte.
Menschen sind aber auch oft einfach faul, deshalb ist es auch ein guter Tipp für Hilfsorganisationen, Spenden so einfach wie möglich zu machen.
„Der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt“
Viele von uns beobachten täglich die Bilder des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und möchten den Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, helfen. Manche beschreiben dann aber Situationen, in denen die geflüchteten Menschen sich nicht so (dankbar) verhalten, wie sie es in dieser Situation erwartet hätten und stempeln diese in der Folge als undankbar ab. Ein Beispiel hierfür ist ein Geflüchteter, der ein Jobangebot nicht annimmt oder unentschuldigt fehlt. Ist Unverständnis hierfür eine normale Reaktion und gerechtfertigt oder schafft es eine Bevölkerung, die noch keine unmittelbare Erfahrung mit Krieg gemacht hat, an dieser Stelle nicht, die Traumata, die diese Menschen erlebt haben, zu verstehen?
Ein Grund dafür, dass wir das Verhalten beispielsweise geflüchteter Menschen nicht verstehen ist, dass Perspektivenübernahme und mich in andere hineinzuversetzen ein riesiger kognitiver Aufwand ist. Diese Menschen sind alle traumatisiert, wenn vielleicht noch die Hälfte ihrer Familie in der Ukraine ist, um die sie jeden Tag Angst haben. Sie sind in einem ganz anderen emotionalen Zustand. In einer solchen Ausnahmesituation verhält man sich natürlich oft auch sozial nicht so aufmerksam. Viele hierzulande können das aber nicht nachempfinden.
Ein anderer Erklärungsansatz ist, dass hier ein statistischer Fehler im Gehirn des „Helfenden“ passiert. Denn wenn ich hundert ukrainische Familien habe und denen helfe, dann sind bestimmt einer oder zwei dabei, die aus der Reihe tanzen oder nicht so reagieren, wie man das möchte. Unser Gehirn fokussiert dann aber oft auf das Negative. Das ist ein spezifischer Fehler im Gehirn, den man auch in der Arbeitspsychologie oder Psychologie der Führung kennt. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass Führungskräfte sagen, dass das nicht funktioniert mit New Work und viel Freiheit und erzählen dann von einer Person, die das letztes Jahr total ausgenutzt hat und zum Beispiel einer während Homeoffice Rasen gemäht hätte. Ganz viele Führungskräfte folgern dann: zu Hause arbeiten die Leute nichts. Der Fehler hierbei ist, dass die Führungskräfte erzählen, dass einer das ausgenutzt habe, er führt aber 20 Personen. Hier spielt wieder die Evolution eine Rolle, da uns unser Gehirn zwingt, uns stärker auf Probleme zu fokussieren als auf Dinge, die gut laufen. Genauso verhält es sich bei den Geflüchteten: Uns fällt der Flüchtling auf, der sich nicht bedankt hat, die anderen, die sich wunderbar einfügen, fallen uns nicht auf. Aber man muss da auch mit uns nachsichtig sein, weil das das Gehirn des Homo sapiens ist. Wir können dem statistischen Fehler aber entgegenwirken, wenn wir den Effekt kennen. Psychoedukation – also Wissen darüber zu erlangen, wie mein Gehirn funktioniert – ist daher so wichtig.
Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali, plädierte in einem Interview im Oktober dafür, nicht „kriegsmüde“ zu werden. Wie kommt es zu Erscheinungen wie Kriegsmüdigkeit?
Hier liegt der klassische Habituationseffekt zugrunde, das heißt am Anfang, wenn wir die Bilder sehen, erleben wir negative Emotionen, Mitgefühl, Angst vor Atomangriffen usw. Das kommt alles überwiegend aus dem limbischen System, aus dem alten Bereich des Gehirns, wo Emotion reguliert wird. Wenn dieser negative Stimulus, der negative Emotionen auslöst, irgendwann nicht mehr so stark wirkt, dann habituieren wir. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, ohne Habituation würden wir wahnsinnig werden, weil uns alles immer wieder genauso schocken würde wie am Anfang. So gewöhnen wir uns auch in Kriegszeiten an die Bilder und werden kriegsmüde. Es ist aber auch eine aversive Geschichte, es macht uns Angst und wir möchten nicht darüber nachdenken. Es ist also eine Mischung aus Habituation und bewusster Ablenkung: „Ich möchte jetzt nicht schlecht drauf sein und überlege lieber, was heute im Kino läuft.“
Tierwohl vs. Fleischkonsum: Warum wir uns selbst belügen und uns manche Menschen gutes Verhalten „schlecht reden“
Ähnlich verhält es sich beim Tierschutz – auch da scheinen Menschen gerne wegzusehen. Mehrere Versuche haben gezeigt, dass Menschen vorgeben, dass ihnen Tierwohl wichtig sei, dann aber doch zu „Billigfleisch“ greifen anstatt nur ein oder zweimal die Woche Fleisch zu essen und dafür das aus guter Haltung zu kaufen. Wie lässt sich dieses scheinbar widersprüchliche Verhalten erklären?
Das ist die Attitude-Behaviour-Gap. Ich frage auch oft in meiner Vorlesung, wer ist gegen Massentierhaltung. Dann melden sich im Audimax 1.000 Leute, weil ja im Prinzip jeder dagegen ist. Dann frage ich: Wer ist Vegetarier? Dann meldet sich nur noch ein Bruchteil. Das ist die klassische Einstellungs-Verhaltens-Lücke. Eine Einstellung hat drei Komponenten, kognitiv, affektiv und verhaltensbasiert: Kognitiv und affektiv wollen wir das Gefühl haben, dass wir es richtig machen und nicht so viel Fleisch essen. Aber wenn es ums konkrete Verhalten geht, sieht die Welt anders aus. Dann kommt noch Impression Management dazu, gerade wenn Menschen öffentlich befragt werden, dann möchte man als ethischer Mensch gelten und sagt eher, dass man spendet oder kein Fleisch isst. Warum das Verhalten dann anders ausfällt, ist zum einen Trägheit. Zum anderen gibt es auch das ökonomische Argument, dass „Billigfleisch“ wirklich günstiger ist, Kosten-Nutzen-Analyse. Manche können oder wollen sich das nicht leisten. Das läuft dann oft auch nicht bewusst-reflektierend ab. 90 Prozent von dem, was wir tun läuft automatisch ab. Das automatische System reagiert spontan auf Trigger wie auch auf ein günstiges Angebot.
Vegetarier oder Veganer beschreiben oft das Phänomen, dass andere Personen zum Teil versuchen zu verhindern, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Obwohl mittlerweile viele Informationen bezüglich Fleischkonsum und dem damit verbundenen Tierleid bekannt sind, wird man als Vegetarier oder Veganer in manchen Kreisen nach wie vor komisch angeschaut, wenn man etwas ohne Fleisch bestellt. Viele üben auch mit Fragen wie „Warum kaufst du dann Ersatzprodukte, wenn du kein Fleisch mehr essen willst?“ Kritik. Warum wollen uns manche Menschen den Verzicht auf Fleisch scheinbar schlecht reden?
Das ist wieder Dissonanz-Reduktion, also die Abwertung der anderen Person, um sein eigenes schlechtes Gewissen abzubauen. Wenn sich einer ein Schnitzel bestellt hat und ein anderer sagt, dass das aber schlecht für die Umwelt und das Tierwohl ist, dann entsteht Dissonanz. Derjenige hat dann zwei Möglichkeiten, entweder er bestellt das Schnitzel ab oder er wertet den anderen einfach ab und behauptet, er übertreibe oder spinne oder sagt sowas wie „Man lebt nur einmal“. Die Dissonanz-Reduktion könnte auf beide Arten erfolgen, aber viele entscheiden sich für die einfachere.
Obwohl etwa Vegetarier und Veganer beide für mehr Tierwohl stehen, ist häufig auch eine Konkurrenz zwischen Tugenden zu beobachten: Warum kommt es etwa dazu, dass Veganer Vegetarier verurteilen?
Bei manchen spielt hier der Selfesteem-Boost eine Rolle. Sie denken also „ich mache es anders als die anderen, ich mache es richtig, habe gesundheitliche Vorteile, schütze das Klima und sorge für Tierwohl“. Das ist natürlich auch gut für den Selbstwert und das dürfen diese Personen ja auch haben, es ist ja eine Win-win-Situation. Soziale Vergleichsprozesse sind unter Menschen normal. Der Nachbar mit dem größeren Haus kommt sich toller vor wie der mit dem kleineren. Social Comparison nennt man diesen Effekt, der geht in beide Richtungen, aber wir vergleichen uns lieber nach unten, weil wir uns damit besser fühlen.
Das Verhalten ist jedoch oft kontraproduktiv und erzeugt Reaktanz. Wenn mir einer von außen sagt, du machst es falsch, du musst es so machen, springt automatisch eine kognitive Einheit, ein Algorithmus an, der sich fragt, ob man das wirklich machen muss und macht oft genau das Gegenteil. Sie werden reaktant. Aber auch hier kommt wieder Psychoedukation zu tragen: Wenn ich weiß, dass es so einen Effekt gibt, weiß ich, dass ich so niemanden von meiner Meinung überzeugen kann.
Klimaschutz: Wollen wir wirklich umsteigen?
In Bezug auf den Umweltschutz ist der Verkehrssektor in Bezug auf den CO2-Ausstoß ein zentrales Thema. Doch besonders Landbewohnern stehen oft einfach keine Öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, um von A nach B zu kommen. Auch ein Verzicht auf Kurzstreckenflüge fällt manchen von uns aufgrund mangelnder guter Alternativen wie etwa teure und gleichzeitig viel längere Zugfahrten oft schwer. Im Gespräch mit manchen Landkreisbewohnern, aber auch Stadtbewohnern, wurde offen gesagt, dass sie unabhängig vom Angebot nicht umsteigen würden. Angenommen der ÖPNV wäre besser ausgebaut und günstiger, welche „verhaltenspsychologischen“ Gründe könnten die Menschen trotzdem noch vom Umstieg abhalten?
Da würde ich grundsätzlich schon sagen, dass viele umsteigen würden. Da geht es wieder um den Homo oeconomicus, der Mensch achtet auf Kosten-Nutzen-Optimierung. Wenn der Preis für den ÖPNV sinkt, ist zu erwarten, dass mehr Leute die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Aber es könnte natürlich auch das Thema „innerer Schweinehund“ greifen, das betrifft wieder die Einstellungs-Verhaltens-Lücke. Ich könnte mit dem Zug fahren, aber fahre doch wieder mit dem Auto, weil es bequemer ist. Aber Menschen lernen natürlich auch aus Erfahrung. Ich hatte das auch mal als unser VW-Bus kaputt war und wir auf den Zug umsteigen mussten. Da dann alles super funktioniert hat, fahren wir seitdem öfter mit dem Zug.
Obwohl etwa beim 9-Euro-Ticket festgestellt wurde, dass oft einfach zusätzliche Fahrten gemacht wurden anstatt Fahrten mit dem Auto durch den Zug zu ersetzen, kann es sein, dass in Zukunft in der ersten Phase Menschen, die es sich zuvor etwa nicht leisten konnten, in den Urlaub zu fahren, per Zug in den Urlaub fahren. Dann gibt es einen Lerneffekt, dass Zugfahren gar nicht so „anstrengend“ ist, sondern zum Teil sogar entspannter ist. Auf Zeit würde man sich dann erwarten, dass allgemein mehr Leute mit dem Zug fahren.
In unserer Umweltreihe verwende ich oft das Zitat vom britischen Polarforscher und Umweltschützer Robert Swan: „Die größte Bedrohung für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn retten wird.“ Viele denken, dass wir einzelnen oder auch Deutschland zu klein oder unbedeutend sind, um eine tatsächliche Änderung für den Klimaschutz zu bewirken. Deshalb fangen viele erst gar nicht damit an, weniger Fleisch zu essen, Plastik zu vermeiden etc. Wie kann die Psychologie dieses Verhalten erklären?
Bei dem Klimathema würde ich sagen, dass es folgendermaßen ist: Eine der größten Katastrophen der Menschheit steht bevor – etwas, das wir uns zum Teil überhaupt nicht vorstellen können. Das Problem ist hier jetzt aber wieder, dass das Homo sapiens Gehirn ziemlich stark in der Gegenwart ist und wir uns wahnsinnig schwer tun, zeitliche Verläufe und exponentielle Zusammenhänge zu sehen. Wir sehen nur lineare Zusammenhänge. Diese ganzen Tipping Points: Regenwald, Jetstream, Golfstrom etc., kippen exponentiell von einem Zustand in den anderen, das sind Kippprozesse. Wenn der Punkt überschritten ist, dann schmilzt der Gletscher einfach weg. Wir haben aber das Gefühl, dass wir dann immer noch gegensteuern können, aber das ist lineares Denken, aber die ganze Welt ist nicht linear. Ein weiterer Grund ist, dass es wieder mit persönlichen Kosten zu tun hat, jeder ist sich selbst der Nächste und ich schaue mir meinen kleinen Bereich an und denke nicht kollektiv. Der Egoismus, wenn man ihn so nennen will, ist hier stärker als der Kollektivismus.
Individuell hängt das Verhalten des Einzelnen aber auch von der Erziehung ab, wenn man immer wieder Humanismus, Zivilcourage etc. beigebracht bekommt, dann hinterlässt das positive Spuren.
Und natürlich hat auch in Deutschland statistisch gesehen jeder Einzelne Einfluss aufs Klima. Den Effekt, dass manche denken, dass ein Einzelner keinen Einfluss hat, beobachtet man auch bei Demokratie- oder Wahlmüdigkeit. Und warum gehen viele nicht zur Wahl? Weil sie denken, diese eine kleine Stimme bei 80 Millionen ist ja gar nichts, aber das ist natürlich ein statistischer Fehler, weil mein Verhalten nicht den Einfluss Null hat. Dass mein Verhalten wieder auf beispielsweise 20 Leute Einfluss hat und diese wieder auf weitere und wieder und wieder, erkennen Menschen oft nicht. Wir unterschätzen diese exponentiellen Kaskadeneffekte, da wir nicht exponentiell denken. Hier könnte wieder Psychoedukation zumindest ein bisschen was bewirken.
Vom Energiesparen in der aktuellen Zeit bis zum Verzicht auf Plastik: Menschen brauchen immer einen Anreiz, um etwas zu verändern. Hierzu müsste ein psychologisches Anreizsystem geschaffen werden.
Wie schaffe ich es, meine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen?
Kann man, unabhängig davon, welches Thema betroffen ist, in den obigen Fällen von einer Art Scheinsolidarität sprechen?
Bezieht man „Schein“ auf Impression Management, würde ich sagen ja. Wenn mich jemand fragt, ob ich alles tue, um Energie zu sparen, dann würde ich sagen „klar“. „Schein“ jedoch nicht im Sinne, dass Leute sich extra solidarisch erklären, aber wissen, dass sie es nicht sind. Der Mensch hat drei Motive: Das Wahrheits-, das Verteidigungsmotiv und Impression Management. Das Wahrheitsmotiv ist, dass man es genau wissen möchte. Je realistischer ich über die Welt Bescheid weiß, desto besser kann ich mich vor Gefahren etc. schützen. Zum anderen haben wir eine Defensivmotivation, wollen also unsere Position verteidigen, das sieht man bei politischen Debatten. Das Dritte ist die Impression Motivation: Da schaue ich, was will mein Umfeld hören, was denken andere „wichtige“ Personen und dann sage ich das Gleiche, weil positiv bewertet werden möchte. Diese drei Motive arbeiten gleichzeitig und es setzt sich immer eins davon etwas mehr durch.
Gibt es Wege, diesem Verhalten entgegenzuwirken? Was kann man als Person, die dieses Verhalten bei sich wiedererkennt, ändern?
Man kann die Einstellungs-Verhaltens-Kluft beispielsweise durch das SMART-Prinzip verkleinern. Das kommt aus der Ziel- und Motivationspsychologie. S steht für spezifisch formulierte Ziele. Diese werden eher umgesetzt als unspezifische. Wenn ich sage: „Ich spende morgen 15 Euro“ und es mir am besten in meine To-Do-Liste schreibe, ist es wahrscheinlicher, dass ich wirklich spende. M steht für messbar. Also dass man sieht, dass man was getan hat. Deshalb bin ich auch ein großer Fan von Social Token Systemen, dass Leute sich Orden durch Spenden verdienen können. Wenn wir spenden, dann weiß das ja kein Mensch. Anders ist es, wenn ich einen Token habe, wo ich sagen kann: Ich habe hier schon Silberstatus durch prosoziales Verhalten, was etwa durch die Bundesregierung zertifiziert ist oder bei einer Bewerbung abgerufen wird.
Wir haben ein Block-Chain-basiertes Token-System entwickelt, durch das man sich Orden verdienen kann. Die Leute machen etwas, sparen etwa Energie im Unternehmen, und immer wenn sie das machen, bekommen sie sofort einen Token automatisiert überwiesen. Am Ende gibt es eine Charity, wo sie auswählen können, an wen sie spenden wollen. Beim letzten Mal kamen fast 800 Euro zusammen. Alle konnten sich aussuchen, ob sie es ausbezahlt haben oder spenden wollen und fast alle haben gespendet. Ich verstehe nicht, warum keiner in Berlin auf solche Ideen kommt. Es muss messbar und sichtbar sein, wenn jemand spendet. Man kann jetzt sagen, der gute Christ spendet auch im Geheimen, aber der Mensch ist nicht so.
A ist akzeptiert, also Ziele, von denen die Leute überzeugt sind. Für Spendenorganisationen heißt das, Leuten kein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ihnen das Gefühl zu geben, dass sie selber die Idee hatten, zu spenden. R ist realistisch. Eine Spende von 15 Euro ist machbar und realistischer als wenn ich sage, ich spende 1.500 Euro. T ist terminiert, das heißt, dass die Leute sehen, dass sie ihr Ziel „spenden“ zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt haben. Das SMART-Prinzip verwendet man deshalb oft, um gute Vorsätze auch wirklich umzusetzen.
Marina Triebswetter | filterVERLAG